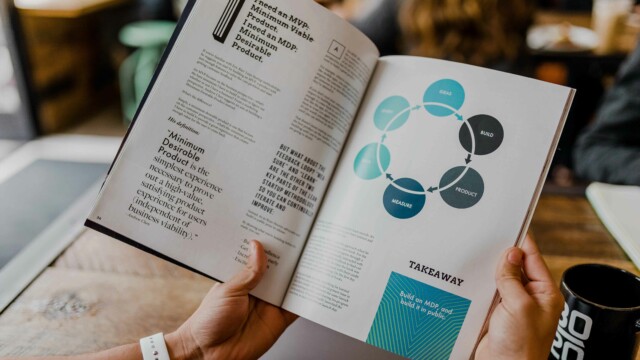Führung ist nichts für mich
Gerne frage ich Menschen nach ihren Ansichten, Strategien und Thesen, da mich ihre Arbeit und Standpunkte faszinieren. Für meine Kolumne NACHGEFRAGT habe ich mit der promovierten Psychotherapeutin Dr. Silke Rusch gesprochen. Sie ist davon überzeugt, dass Frauen ihr wahres berufliches Potenzial entfalten könnten – wenn sie u.a. ihre limitierenden Glaubenssätze abbauen würden. Ich habe sie gefragt, warum viele Frauen glauben, dass Führung nichts für sie sei.
Mario: Silke, Sie sprechen in Ihrem neuen Buch auch über den Glaubenssatz vieler Frauen: „Führung ist nichts für mich.“ Warum glauben Sie, ist dieser Satz so weit verbreitet?
Silke: Dieser Glaubenssatz hat tief verwurzelte Ursachen. Viele Frauen können kein Führungsselbstbild entwickeln. Das liegt zum einen an gesellschaftlichen Stereotypen, die Führung seit Jahrhunderten als männlich konzipieren – Eigenschaften wie Dominanz, Durchsetzungsfähigkeit oder Aggressivität werden als typisch männlich abgespeichert. Frauen, die eher communal traits zeigen – also Fürsorge, Kooperation oder Sensibilität – fühlen sich oft nicht angesprochen oder halten sich für ungeeignet.
Mario: Wie beeinflusst diese gesellschaftliche Prägung das Selbstbild von Frauen im Hinblick auf Führungsrollen?
Silke: Die kollektiven Erwartungen prägen das sogenannte Führungsselbstbild enorm. Wenn Frauen sich selbst nicht mit den stereotypen Eigenschaften einer Führungskraft identifizieren können, weil sie beispielsweise introvertiert sind oder eher kooperativ handeln, dann entsteht der Eindruck: „Führung ist nichts für mich.“ Zudem gibt es kaum weibliche Vorbilder in Führungspositionen, was den Effekt verstärkt. Ohne sichtbare Role Models fällt es vielen schwer, sich eine eigene Führungsrolle vorzustellen.
Mario: Sie erwähnten die Bedeutung von Role Models. Warum sind sichtbare weibliche Vorbilder so entscheidend?
Silke: Sichtbare Role Models sind essenziell, weil sie das Bild von Führung verändern und erweitern. Studien zeigen, dass Frauen ihre Einstellung zu bestimmten Berufsfeldern oder Rollen stark durch das prägen, was sie umgibt. Ein Beispiel aus den USA zeigt: Wenn Frauen Bilder weiblicher Wissenschaftlerinnen sehen oder über erfolgreiche Frauen lesen, steigt ihre Bereitschaft, sich in MINT-Fächern zu engagieren. Das berühmte Zitat „You can’t be what you can’t see“ bringt das auf den Punkt: Ohne sichtbare Vorbilder fällt es Frauen schwer, sich selbst in solchen Rollen zu sehen.
Mario: Welche Rolle spielen Unternehmenskulturen bei der Ablehnung von Führungsverantwortung durch Frauen?
Silke: Unternehmenskulturen, die männlich geprägt sind und bestimmte Machtstrukturen etablieren, wirken abschreckend auf viele Frauen. Das betrifft zum Beispiel Phänomene wie Catcalling, rein männliche Netzwerke oder gewaltvolle Kommunikation. Studien belegen, dass statusorientierte Kulturen mit aggressivem Wettbewerb und Hierarchiedenken oft unattraktiv für weibliche Mitarbeitende sind. Zudem erleben Frauen sogenannte Backlash-Effekte: zeigen sie stereotyp-männliche Eigenschaften, riskieren sie negative Bewertungen und den Verlust ihrer Sympathie.
Mario: Wie wirkt sich dieser Mangel an Unterstützung und Vorbilder auf die Karriereentscheidungen von Frauen aus?
Silke: Viele Frauen entscheiden sich gegen eine Führungslaufbahn, weil sie beobachten, dass ihre weiblichen Chefinnen gegen Widerstände kämpfen müssen oder unbeliebt sind. Das Modelllernen funktioniert hier negativ: Wenn sie sehen, dass weibliche Führungskräfte isoliert sind oder ständig gegen Windmühlen kämpfen, sinkt die Motivation erheblich. Zudem berichten viele Frauen, dass ihnen keine adäquaten Entwicklungsmöglichkeiten geboten werden, insbesondere nach einer Mutterschaft.


Dr. Silke Rusch ist promovierte Psychotherapeutin, die sich bereits im Studium auch für den Bereich der Personalpsychologie begeisterte. Nach einigen Jahren in der Forschung führte sie ihr Weg in die Akutpsychiatrie. Dort verantwortet sie seit 2015 die Leitung von zwei Teams mit etwa 50 Mitarbeitenden, arbeitet als Supervisorin und lehrt als Dozentin an den Universitäten Marburg und Gießen. Sie gilt als geschätzte Fachexpertin für Angst- und Zwangsstörungen sowie Suizidalität. Als Gründerin der FemLead Factory berät sie Frauen, die im Beruf straucheln und mental gesund bleiben wollen.
Mario: Inwiefern beeinflusst die Care-Situation von Frauen ihre Karriereentscheidungen im Vergleich zu Männern?
Silke: Studien zeigen, dass Frauen bei Karriereentscheidungen ihre Care-Situation ständig mitdenken. Sie berücksichtigen Faktoren wie Kinderbetreuung und Familienverantwortung stärker als Männer, die oft weniger Sorgeverantwortung übernehmen und dadurch freier entscheiden können. Wenn Frauen wahrnehmen, dass Führung in Teilzeit unmöglich ist, Elternzeit als Karrierekiller gilt oder Meetings am Spätnachmittag stattfinden, erscheint ihnen eine Karriere im Unternehmen nicht realistisch.
Mario: Gibt es konkrete Maßnahmen oder Strategien, um diesen Glaubenssatz bei Frauen aufzubrechen?
Silke: Ja, absolut. Wichtig ist vor allem die Sichtbarkeit weiblicher Role Models in Führungspositionen – sowohl innerhalb des Unternehmens als auch in der Öffentlichkeit. Mentoring-Programme und Netzwerke können helfen, das Selbstvertrauen zu stärken. Zudem sollten Unternehmen eine Kultur fördern, die Vielfalt in Führung sichtbar macht und stereotype Erwartungen hinterfragt. Auch individuelle Coachings können dazu beitragen, innere Blockaden abzubauen und ein positives Führungsselbstbild zu entwickeln.
Mario: Abschließend gefragt: Was können Organisationen tun, um mehr Frauen für Führungsrollen zu gewinnen?
Silke: Organisationen sollten bewusst an ihrer Unternehmenskultur arbeiten: Mehr Diversität in Sichtbarkeit bringen und aktiv Role Models präsentieren. Es braucht eine offene Kommunikation darüber, dass Führung vielfältig sein kann – inklusive Eigenschaften wie Introversion, Empathie und Kooperation. Außerdem sollten flexible Arbeitsmodelle sowie gezielte Entwicklungsprogramme angeboten werden – damit mehr Frauen/Mütter partizipieren und erkennen können: „Führung ist auch für mich möglich.“ Und letztlich gilt: Sichtbarkeit schafft Akzeptanz.
Mario: Wie können Frauen ihre eigenen Vorstellungen von Führung entwickeln und verändern?
Silke: Es ist hilfreich, sich eine positive Vision von Führung zu kreieren. Fragen wie „Wie wäre meine perfekte Führungskraft?“ oder „Welche Eigenschaften sollte sie haben?“ helfen dabei, das männlich geprägte Stereotyp zu hinterfragen und eigene, individuelle Bilder zu entwickeln. Dabei sollten Frauen ihre berufliche Nische berücksichtigen – denn Führung in der IT sieht anders aus als in der Schule oder im sozialen Bereich.
Mario: Welche Rolle spielen persönliche Erfahrungen beim Aufbrechen dieses Glaubenssatzes?
Silke: Wir dürfen uns bewusst machen: Wir alle wurden schon oft im Leben geführt – von Eltern, Erzieher:innen, Lehrkräften. Erfahrungen mit erfolgreichen Leaderinnen, die vielleicht ganz anders sind als das stereotype Bild – etwa empathisch, kommunikativ und kooperativ – können sehr inspirierend sein. Es lohnt sich, bewusst positive Beispiele zu reflektieren: Was mag man an ihnen? Was bewundert man? Das hilft dabei, eigene Vorstellungen zu erweitern und alte Klischees abzubauen.
Mario: Wie wichtig ist es für Frauen, ihre eigenen Eigenschaften wertzuschätzen?
Silke: Sehr wichtig! Mir persönlich hat immer der Gedanke geholfen, dass Mitarbeitende nicht kündigen, weil eine Führungskraft „zu empathisch“ war. Wohl aber, weil sie zum Beispiel zu unflexibel oder ignorant war. Von der Industrialisierung bis zur Arbeitswelt 4.0 haben sich die Anforderungen an gute Führung stark gewandelt. Frauen können heute mit ihren Eigenschaften ebenso punkten wie Männer.
Mario: Gibt es typische Missverständnisse darüber, was eine erfolgreiche Führungskraft ausmacht?
Silke: Ja. Ein häufiges Missverständnis ist die Annahme, dass nur dominante und aggressive Eigenschaften zum Erfolg führen. Dabei zeigen Studien immer wieder: Empathie, Kommunikationsstärke und Flexibilität im Denken sind heute entscheidende Kompetenzen. Viele Frauen bringen diese Fähigkeiten mit – sie passen perfekt in die neue Arbeitswelt.
Mario: Wie können Frauen ihr Selbstvertrauen stärken, um den Schritt in eine Führungsrolle zu wagen?
Silke: Indem sie kleine Schritte machen: z.B. Meetings moderieren, strategische Ideen vorschlagen oder Projektleitungen übernehmen. Das Sammeln erster Erfahrungen gibt Sicherheit. Außerdem hilft es, in Phasen zu denken: „Ich probiere es einfach mal für ein Jahr.“ So wird eine Beförderung weniger wie eine lebenslange Entscheidung gesehen.
Mario: Sie sprechen vom Experimentieren mit Führung. Warum ist das so wichtig?
Silke: Viele Frauen zögern aus Angst vor Fehlern oder weil sie sich keine klare Vorstellung machen können, ob sie als Leaderin funktionieren würden. Das Ausprobieren in kleinen Rollen – Teamleitung, Moderation oder Mentoring – ermöglicht es ihnen herauszufinden: Passt das zu mir? Und schafft Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten.
Mario: Wie kann das Denken in Phasen helfen, den Mut zur Führung zu entwickeln?
Silke: Es erleichtert den Einstieg enorm. Wenn Frauen sich vorstellen können: „Ich probiere es für ein Jahr“, nehmen sie den Druck raus und sehen Leadership als einen Prozess des Lernens und Wachsens. Das reduziert Ängste vor endgültiger Veränderung und macht den Schritt greifbarer.
Mario: Was raten Sie Frauen konkret, um alte Glaubenssätze aufzulösen?
Silke: Sie sollten sich bewusstmachen: Der Glaube „Führung ist nichts für mich“ basiert oft auf patriarchalen Vorstellungen oder mangelndem Selbstvertrauen. Stattdessen empfehle ich: Entwickeln Sie Ihre eigene Vision von Leadership! Fragen Sie Freundinnen oder Kolleginnen um Feedback – oft sehen andere mehr Potenzial in uns als wir selbst. Und denken Sie daran: Auch Kinder probieren vieles zum ersten Mal – warum nicht auch Sie? Mut entsteht durch Erfahrung. Aussteigen kann man immer.
Mario: Welche Rolle spielt die gesellschaftliche Veränderung bei der Entwicklung neuer Führungsbilder für Frauen?
Silke: Eine große! In einer digitalisierten, globalisierten Welt mit hybriden Arbeitsmodellen braucht es neue Führungsstile. Empathie, Kommunikation und Resilienz werden immer wichtiger. Mitarbeitende brauchen keine Kontrolle, sondern Struktur und Unterstützung. Wenn wir alte Stereotype hinterfragen und neue Narrative schaffen – etwa durch Sichtbarkeit erfolgreicher weiblicher Leader –, öffnen wir Türen für mehr Vielfalt in Führungspositionen.
Mario: Liebe Silke, herzlichen Dank, dass ich bei Ihnen nachfragen durfte.
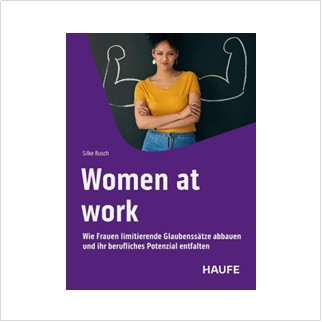
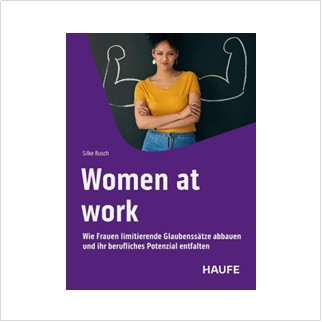
Women at work
Einerseits sind Frauen zunehmend in Fach- und Führungspositionen vertreten. Gleichzeitig stehen sie jedoch unter enormem inneren Druck. Tief verwurzelte Glaubenssätze und gesellschaftliche Normen führen oft zu Erschöpfung, Selbstzweifeln oder sogar psychischen Krisen, die ihre berufliche Leistungsfähigkeit beeinträchtigen. Dr. Silke Rusch deckt die verborgenen Muster auf, die Frauen in ihrer Karriere bremsen, und bietet praxiserprobte Methoden zur Überwindung dieser Barrieren. Sie beleuchtet die Ursprünge weiblicher Glaubenssätze und stellt wirkungsvolle Übungen vor, um die Work-Life-Balance zu verbessern und eine selbstbestimmte berufliche Vision zu entwickeln. Dieses Buch ist ein unverzichtbarer Begleiter für Frauen, die mental gestärkt ihre berufliche Entwicklung vorantreiben wollen.