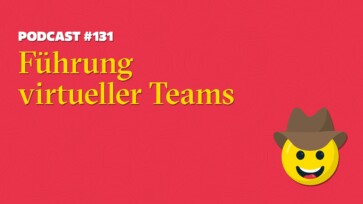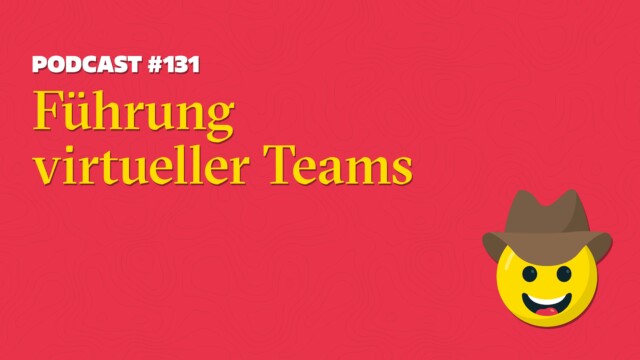Die Säulen der Selbstorganisation
Gerne frage ich Menschen nach ihren Ansichten, Strategien und Thesen, da mich ihre Arbeit und Standpunkte faszinieren. Für meine Kolumne NACHGEFRAGT habe ich mit dem Agile Coach und Berater Bernhard Eickenberg gesprochen. Er ist davon überzeugt, dass die besten Ergebnisse dann entstehen, wenn Teams Verantwortung übernehmen und Führung nicht durch Kontrolle, sondern durch Unterstützung geprägt ist.
Mario: Bernhard, wenn ich Dich und Dein Buch richtig verstehe, dann stellst Du Dir das Leben einer Führungskraft in einem selbstorganisierten Unternehmen so vor: Du kommst an einem Montagmorgen nach einem zweiwöchigen, ungestörten Urlaub zurück an Deinen Arbeitsplatz. 14 Tage lang hast Du weder das Diensthandy klingeln hören, noch musstest Du auf berufliche E-Mails antworten. Und dann? Was erwartet Dich noch, wenn Du wiederkommst?
Bernhard: Wenn ich ankomme, entdecke ich manchmal Probleme, die während meiner Abwesenheit entstanden sind. Ein Dienstleister für ein bevorstehendes Event ist abgesprungen, und es musste kurzfristig eine Entscheidung für einen Ersatz getroffen werden. Früher wäre das meine Aufgabe gewesen – ich hätte den Stress gehabt, mich sofort darum zu kümmern. Aber heute ist das anders. Weil wir ein selbstorganisiertes Unternehmen sind, haben meine Mitarbeitenden die Initiative ergriffen und das Problem gelöst, noch bevor ich überhaupt davon erfahren habe. Vielleicht sind sie nicht genau so vorgegangen wie ich es getan hätte, aber sie haben es gelöst – schnell und entschieden.
Mario: Klingt fast utopisch …
Bernhard: Nur dann, wenn man seine Mitarbeitenden wirklich von sich abhängig gemacht hat. Das ist der Knackpunkt: In den meisten Organisationen fehlt es an Selbstorganisation. Damit meine ich den Zustand, in dem Mitarbeitende aufkommende Fragestellungen selbstständig lösen können – und dabei genau wissen, wie sie vorgehen müssen. Mein Framework dazu, die fünf Säulen der Selbstorganisation, sagt, dass so etwas nur gelingen kann, wenn das Umfeld die richtigen Bedingungen für Selbstorganisation bietet. Eben die namensgebenden fünf Säulen: Selbstbestimmung, Alignment (Ausrichtung), Transparenz, Motivation und Kompetenz sowie ein Fundament aus Vertrauen.
Mario: Du sagst, Selbstorganisation sollte als Spektrum verstanden werden. Was meinst Du damit?
Bernhard: Der ideale Grad der Selbstorganisation ist individuell unterschiedlich und muss gemeinsam zwischen Führungskraft und Team gefunden werden. Es geht nicht darum, den maximalen Grad an Selbstorganisation zu erreichen. Es ist vielmehr wichtig, sicherzustellen, dass die 6 Bauelemente den aktuellen Grad an Selbstorganisation wirklich stabil stützen. Auf schiefen Säulen hält kein Dach.
Mario: Was ist Deiner Meinung nach das Ziel von Selbstorganisation?
Bernhard: Es geht nicht darum, als Führungskraft den nächsten Urlaub Ruhe zu haben – obwohl das sicherlich attraktiv ist. Sondern es geht darum, das Unternehmen robuster und erfolgreicher zu gestalten. Unsere Welt ist heute deutlich schneller geworden als früher: Unternehmen entstehen und vergehen rascher, technologische Innovationen entwickeln sich in atemberaubendem Tempo und geopolitische sowie klimatische Veränderungen beeinflussen die Märkte weltweit enorm. Selbstorganisation hilft, mit dieser Geschwindigkeit mitzuhalten.
Mario: Und warum ist Geschwindigkeit so entscheidend für den Erfolg eines Unternehmens in diesem Umfeld?
Bernhard: Weil wir uns ständig anpassen müssen. Die Antwortzeiten auf Veränderungen müssen deutlich verkürzt werden. Projekte und Produktentwicklungen müssen beschleunigt werden – letztlich geht es um die Entscheidungsgeschwindigkeit im Unternehmen. Die klassische Hierarchie mit langen Wegen für Informationen nach oben und Entscheidungen nach unten ist viel zu langsam geworden, um mit dem Markt mitzuhalten. Unternehmen müssen Wege finden, Verantwortung nach unten zu delegieren und Mitarbeitende in die Lage versetzen, schnelle Entscheidungen im Sinne des Unternehmens zu treffen.


Dr. Bernhard Eickenberg ist Agile Coach und Berater für unternehmerische Selbstorganisation. Er begleitet Unternehmen, die sich in einer sich ständig wandelnden Arbeitswelt neu aufstellen möchten. Sein Schwerpunkt: eine Unternehmenskultur gestalten, in der Mitarbeitende mehr Verantwortung übernehmen und sich selbst rund um Wertschöpfung organisieren. Seit 2016 unterstützt er Teams und Führungskräfte dabei, agile Methoden und selbstorganisierte Strukturen in der Praxis zu verankern – immer mit einem Fokus auf pragmatische Lösungen und nachhaltige Veränderungen.
Mario: Und wie hängt das mit Selbstorganisation zusammen?
Bernhard: Wenn ich jede wichtige Entscheidung durch Führungskräfte treffen lasse – also alles zentral steuere –, entstehen Verzögerungen. Informationen müssen durch Hierarchien laufen; Entscheidungen landen in Gremienmeetings – das kostet Zeit und kostet Marktchancen. Um flexibel zu bleiben, müssen Verantwortlichkeiten nach unten verlagert werden: Wenn Teams an der Peripherie des Unternehmens eigenständig handeln dürfen – sobald sie Veränderungen im Markt wahrnehmen –, steigt die Geschwindigkeit enorm. Auch Taskforces innerhalb von Abteilungen können bei Problemen an Schnittstellen schnell reagieren. Es geht darum, ein System aufzubauen, in dem Mitarbeitende sich selbst organisieren können – genau verstehen, was das Unternehmen von ihnen braucht – und dieses dann auch leisten. Es bedeutet Verantwortung abzugeben und diejenigen zu befähigen, die Verantwortung übernehmen wollen oder sollen.
Mario: Was bedeutet das konkret für die tägliche Arbeit eines Unternehmens?
Bernhard: Es bedeutet vor allem: Verantwortung abgeben! Nicht alles zentral steuern wollen sondern den Mitarbeitenden vertrauen und ihnen Freiräume geben zum Entscheiden und Handeln im Sinne des Gesamtunternehmens. So entsteht ein System der Selbstorganisation – eines Systems also, das sich selbst korrigiert und anpasst. Wenn das Umfeld stimmt.
Mario: Und wie genau müsste dieses Umfeld aussehen, damit Selbstorganisation funktioniert?
Bernhard: Ich nutze da immer gerne die Analogie einer Heizung. Stellen Sie sich vor: Sie haben einen alten Holzofen, wie vielleicht auf einer Wandertour oder in einer Skihütte schon erlebt. So ein altes Ding aus Gusseisen. Wenn man so einen Ofen bedient, merkt man schnell: Es ist gar nicht so einfach, die Temperatur konstant zu halten. Man legt Scheite nach, aber wenn man zu hastig zu viele auf einmal reinwirft, schießt die Temperatur nach oben. Dann schwitzt man und öffnet die Fenster, um die Hitze abzulassen. Oder man wartet zu lange, bis es einem kalt wird, und dann braucht es eine Weile, um die Temperatur wieder hochzuschieben. Am Ende pendelt die Temperatur mal mehr, mal weniger um den gewünschten Wert – manuelles Eingreifen ist regelmäßig notwendig. So führen viele Führungskräfte ihre Teams. Sie greifen ständig in die Arbeit ein, korrigieren hier, weisen dort an. Wenn sie mal nicht da sind, bleiben Fragen ungelöst und die Arbeit staut sich.
Mario: Und wie sieht Selbstorganisation dagegen aus?
Bernhard: Wie eine moderne Automatikheizung. Hier haben wir einen Temperatursensor im Raum und ein Panel an der Wand, an dem wir die Wunschtemperatur einstellen. Die Heizung übernimmt den Rest – sie reguliert automatisch. Wir müssen weder ständig nachregeln noch kontrollieren, wie hoch die Temperatur gerade ist. Wenn doch einmal eine größere Abweichung besteht, rufen wir den Reparaturdienst. Gute Selbstorganisation ist wie diese selbstregulierende Heizung: Wir einigen uns mit unseren Mitarbeitenden auf sinnvolle Ziele und lassen sie dann selbst regulieren – entlang dieser Ziele. Wenn etwas „kaputt“ geht oder nicht läuft wie gewünscht, sorgen wir für eine „Reparatur“, zum Beispiel durch Coaching oder Unterstützung.
Mario: Das klingt nach einem idealen Zustand. Was sind denn die Rahmenbedingungen dafür? Welche Voraussetzungen braucht es für Selbstorganisation?
Bernhard: Genau das sind die fünf Säulen der Selbstorganisation: Selbstbestimmung, Alignment (Ausrichtung), Transparenz, Motivation und Kompetenz – plus einem soliden Fundament aus Vertrauen. Diese Bausteine liefern die Grundlage dafür, dass sich ein System selbst regulieren kann.
Mario: Bernhard, Du sprichst von bestimmten Säulen, die das Prinzip der Selbstorganisation stützen. Kannst Du diese näher erläutern? Wie funktionieren sie im Zusammenspiel?
Bernhard: Gerne. Die erste Säule ist Selbstbestimmung: Die Heizung muss eigenständig entscheiden können, wann sie heizt oder nicht. Würde sie jedes Mal um Erlaubnis fragen – etwa per Bing-Ton –, würde das den Ablauf stören und die Temperatur unkontrolliert schwanken lassen. Genauso ist es im Team: Wenn Mitarbeitende keine Entscheidungskompetenz haben, entstehen Verzögerungen und Ineffizienzen.
Mario: Das klingt nach einem klaren Prinzip. Und was ist die zweite Säule?
Bernhard: Die zweite Säule ist Alignment, also Ausrichtung. Damit die Heizung richtig arbeitet, braucht sie ein klares Ziel – eine Wunschtemperatur. Ohne dieses Ziel kann sie nicht regulieren. Bei Teams gilt dasselbe: Ohne gemeinsames Zielverständnis laufen Mitarbeitende Gefahr, Dinge zu tun, die nicht zum gewünschten Ergebnis passen. Wenn du dann wieder manuell eingreifst und korrigierst, hast du den natürlichen Regelmechanismus der Selbstorganisation unterbrochen.
Mario: Das macht Sinn. Wie wichtig ist denn die Transparenz in diesem System?
Bernhard: Sehr wichtig. Ohne einen Sensor weiß die Heizung nicht genau, welche Temperatur im Raum herrscht – sie kann nur auf Basis der Daten arbeiten. Für Teams bedeutet das: Es braucht klare Kennzahlen und regelmäßige Informationen darüber, wo man steht in Bezug auf die Ziele.
Mario: Und wie wirkt sich Motivation auf dieses System aus?
Bernhard: Hier zeigt sich der Unterschied zur Heizung deutlich – Mitarbeitende haben einen eigenen Willen und tragen Verantwortung für ihre Arbeit. Ihre Motivation beeinflusst maßgeblich den Erfolg der Selbstorganisation.
Mario: Das klingt nach einem entscheidenden Faktor. Gibt es noch eine weitere Säule?
Bernhard: Ja, schließlich ist da noch die Kompetenz: Die Heizung muss richtig programmiert sein; Mitarbeitende brauchen die nötigen Fähigkeiten – sowohl fachlich als auch in Bezug auf Selbstorganisation –, um ihre Aufgaben erfolgreich zu erfüllen. Das bedeutet oft Schulung oder Weiterentwicklung.
Mario: Wenn all diese Säulen zusammenwirken, entsteht also ein System? Wie sieht dieses aus?
Bernhard: Genau. Mit diesen fünf Säulen entsteht ein System, das sich selbst reguliert – innerhalb der vorgegebenen Ziele.
Mario: Das klingt sehr durchdacht. Gibt es praktische Beispiele dafür, wie diese Säulen in der Realität umgesetzt werden?
Bernhard: Ein gutes Beispiel ist ein autonom arbeitendes Team in einer Organisation: Sie haben klare Ziele (Alignment), wissen genau, wo sie stehen (Transparenz), sind motiviert und verfügen über die notwendigen Fähigkeiten (Kompetenz). Die Entscheidungskompetenz (Selbstbestimmung) erlaubt ihnen, flexibel auf Veränderungen zu reagieren, ohne ständig auf Anweisungen warten zu müssen. So funktioniert Selbstorganisation in der Praxis.
Mario: Und was ist das Fundament für diese Säulen? Was ist die Voraussetzung dafür, dass eine solche Selbstorganisation funktionieren kann?
Bernhard: Das Fundament heißt Vertrauen. Es ist essenziell für funktionierende Selbstorganisation: Wir müssen über Probleme offen reden können, ohne Sorge haben zu müssen, dass uns das negativ ausgelegt wird. Wir müssen einerseits darauf vertrauen können, dass Mitarbeitende Fehler offenlegen ohne Gefahr vor Sanktionen zugeben. Aber auch, dass sie ohne Sorge vor Strafe auf Fehler hinweisen und konstruktiv kritisieren. Was nicht jeder Führungskraft gefällt, aber wesentlich für den gemeinsamen Erfolg ist.
Dieses gegenseitige Vertrauen zwischen Führungskraft und Team ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Transformation hin zu mehr Selbstorganisation. Es geht dabei mehr um moralisches Vertrauen als nur um Kompetenz; beide Seiten müssen sicher sein können: Ich vertraue dir genug, damit du eigenständig handeln kannst; du vertraust mir genug, um offen über Probleme sprechen zu können.
Mario: Das klingt nach einer Grundvoraussetzung für Veränderung. Ist vollständige Selbstorganisation immer das richtige Ziel?
Bernhard: Ich würde sagen, Selbstorganisation ist erstmal gar kein Ziel, weil es kein fest definierter Endzustand ist. Es geht vielmehr um ein Spektrum. Wie viel Selbstorganisation brauche ich in meinem Betrieb, damit er gut funktioniert? Diese Antwort wird immer unterschiedlich ausfallen, je nach Branche, Unternehmen und aktueller Situation. Es gibt kein Unternehmen, in dem es nicht bereits Selbstorganisation gäbe – im mindesten die „hilfreiche illegale Selbstorganisation“ um dysfunktionale Prozesse herum. Die Frage ist: reicht das oder braucht es mehr Freiheit für die Mitarbeitenden? Studien konnten zeigen, dass ein höherer Grad an Selbstorganisation in der Regel mit mehr Umsatz einhergeht. Das ist doch schonmal ein schöner Anreiz, oder? Und wo das Optimum für Selbstorganisation liegt, das kann ich eigentlich nur ausprobieren. Indem ich die Säulen Stück für Stück höher liege – gleichmäßig, damit das Dach hält – und dann schaue, wie es sich nach jeder „Bauphase“ anfühlt.
Mario: Abschließend gefragt: Was möchtest Du Führungskräften mit Deinem Ansatz mitgeben?
Bernhard: Dass sie lernen sollten, Verantwortung wirklich nach unten zu delegieren statt alles zentral steuern zu wollen. Denn nur so kann ein Unternehmen schnell reagieren und flexibel bleiben in einer Welt im ständigen Wandel. Es geht darum, Strukturen aufzubauen, in denen Mitarbeitende genau wissen: Was wird von mir erwartet? Wie kann ich dazu beitragen, dass wir gemeinsam erfolgreich sind? Und vor allem: Wie kann ich selbstbestimmt handeln? Denn wer diese Prinzipien lebt – Selbstbestimmung, Alignment, Transparenz etc.– schafft eine Unternehmenskultur der Agilität.
Mario: Lieber Bernhard, herzlichen Dank, dass ich bei Dir nachfragen durfte.
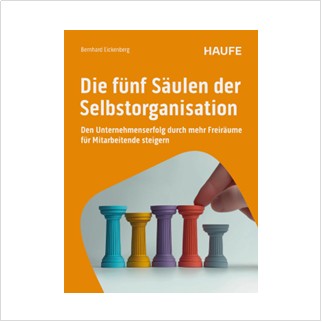
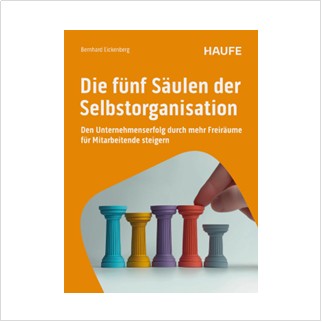
Die fünf Säulen der Selbstorganisation
Der Wandel hin zu mehr Selbstorganisation in der Arbeitswelt, geprägt durch Agilität und New Work, ist nicht nur spürbar, sondern wird von den Beschäftigten aktiv gefordert. Unternehmen müssen Wege finden, ihren Mitarbeitenden Verantwortung zu übertragen und sie zu befähigen, schnelle Entscheidungen im Sinne des Unternehmens zu treffen. Das von Bernhard Eickenberg entwickelte Modell der fünf Säulen der Selbstorganisation bietet ein hilfreiches Framework dafür. Es zeigt, welche grundlegenden Voraussetzungen und Rahmenbedingungen Führungskräfte und Unternehmen schaffen müssen, damit Mitarbeitende eigenverantwortlich und selbstbestimmt arbeiten können. Mit dem Ziel, ein lebendiges und ermächtigendes Arbeitsumfeld zu gestalten, in dem Mitarbeitende motiviert an einem Strang ziehen.