Alles steht Kopf
Gerne frage ich Menschen nach ihren Ansichten, Strategien und Thesen, da mich ihre Arbeit und Standpunkte faszinieren. Für meine Kolumne NACHGEFRAGT habe ich mit dem geschäftsführenden Gesellschafter bei flow Consulting Dieter Kannenberg gesprochen. Er ist davon überzeugt, dass es wichtig ist, die informellen Einfluss- und Machtstrukturen innerhalb einer Organisation sichtbar zu machen. Ich habe ihn gefragt, wie ein solches Bild den Veränderungsprozess beeinflussen kann.
Mario: Dieter, Du sprichst in Deinem neuen Buch von einem Tool namens „Organigramm verkehrt“. Kannst Du kurz erklären, worum es bei diesem Ansatz geht?
Dieter: Das Tool „Organigramm verkehrt“ ist eine Methode, um die informellen Einfluss- und Machtstrukturen innerhalb einer Organisation sichtbar zu machen. Es geht darum, zu analysieren, wie Mitglieder außerhalb des offiziellen Organigramms Einfluss nehmen, welche Rollen sie einnehmen und wie sie miteinander verbunden sind. Dabei wird die Perspektive der Beteiligten genutzt, um ein Bild zu erstellen, das hilft, den Veränderungsprozess gezielt zu steuern.
Mario: Wie unterscheidet sich dieses Tool von einem klassischen Organigramm?
Dieter: Ein klassisches Organigramm zeigt die formale Hierarchie und Verantwortlichkeiten. Das „verkehrte“ Organigramm hingegen basiert auf subjektiven Einschätzungen der Mitarbeitenden und visualisiert die informellen Beziehungen und Einflussnahmen. Es spiegelt also nicht die offizielle Struktur wider, sondern die tatsächlichen Macht- und Beziehungsgeflechte aus Sicht der Beteiligten.
Mario: Welche Erfahrungen hast Du gemacht, wenn Teams oder Führungskräfte dieses Tool anwenden?
Dieter: Es ist erstaunlich, welche Erkenntnisse dabei zutage treten. Man entdeckt oft Personen im Mittelpunkt des Einflusses, die bisher kaum beachtet wurden. Es kann auch bestätigen, was man schon vermutet hat, oder Hinweise geben, wie Maßnahmen noch besser fokussiert werden können. Das Besondere ist, dass durch die subjektive Perspektive neue Zusammenhänge sichtbar werden, die im rationalen Analysieren oft verborgen bleiben.
Mario: Wie läuft der konkrete Prozess bei der Anwendung dieses Tools ab?
Dieter: Zunächst legen wir den Rahmen fest – also die Organisationseinheit oder das Veränderungsvorhaben. Dann zeichnen wir gemeinsam ein Bild der Organisation auf einer Pinnwand oder digital. Dabei vergeben wir Etiketten an Personen – zum Beispiel „Einflussreicher“, „Kommunikator“, „Skeptiker“ – und definieren die Beziehungsgeflechte zwischen ihnen. Durch diese Analogie entsteht ein Bild, das uns erste Schlussfolgerungen für den Umgang mit den Beteiligten ermöglicht.
Mario: Welche Vorteile bietet diese Methode im Vergleich zu rein rationalen Analysen?
Dieter: Der große Vorteil liegt darin, dass sie subjektive Deutungen und Interpretationen nutzt. Dadurch werden Zusammenhänge sichtbar gemacht, die im Kopf nur unklar sind oder in Zahlen schwer fassbar wären. Es fördert das Verständnis für komplexe soziale Dynamiken und hilft dabei, Strategien für den Veränderungsprozess gezielt anzupassen.
Mario: Kannst Du ein Beispiel nennen, wie dieses Tool in der Praxis genutzt wird?
Dieter: Stellen Sie sich vor, bei einem Veränderungsprojekt zeigt sich Widerstand in bestimmten Gruppen. Mit dem „verkehrten“ Organigramm identifizieren wir Personen oder Gruppen mit hohem Einfluss – auch wenn sie formal keine Führungsposition haben – und analysieren ihre Beziehungen zueinander. Daraus ergeben sich konkrete Ansatzpunkte: Vielleicht gibt es Schlüsselpersonen, deren Unterstützung entscheidend ist. Oder es zeigt sich eine Gruppe, die bisher übersehen wurde und nun gezielt angesprochen werden sollte.


Dieter Kannenberg, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der flow consulting gmbh, war viele Jahre in der Evaluationsforschung tätig. Er hat gemeinsam mit Partnern aus den USA das Power-Potential-Profile® zur Selbstanalyse der Führungspersönlichkeit entwickelt. Als Lizenzgeber bildet er Trainer, Consultants und Coaches in diesem Instrument und in dem Konzept der iterativen Beratung von flow consulting aus. Das Konzept des Action-Learnings hat er in vielen Beratungsprojekten kundenindividuell weiterentwickelt und erfolgreich umgesetzt. Weitere Schwerpunkte von Dieter Kannenberg: Executive Coaching und Strategieberatung.
Mario: Was ist Deiner Meinung nach das wichtigste Ergebnis oder Learning aus der Anwendung dieses Tools?
Dieter: Das Wichtigste ist das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass Macht und Einfluss nicht nur in offiziellen Strukturen liegen. Oft sind es informelle Netzwerke und Beziehungen, die den Wandel maßgeblich beeinflussen. Wenn wir diese verstehen und sichtbar machen können, sind wir viel besser in der Lage, Veränderungsprozesse erfolgreich zu steuern und Widerstände konstruktiv zu nutzen.
Mario: Dieter, was sind die wichtigsten Voraussetzungen für den Einsatz des Tools „Organigramm verkehrt“?
Dieter: Zunächst muss klar sein, welche Organisationseinheit von dem geplanten Veränderungsvorhaben betroffen ist. Nur so können wir die relevanten Personen oder Gruppen definieren, die im „verkehrten“ Organigramm betrachtet werden sollen. Das Tool eignet sich besonders, wenn noch unklar ist, wie die Gruppendynamik und Machtverhältnisse innerhalb der Organisation aussehen. Wichtig ist auch, dass die Teilnehmenden bereit sind, analog zu arbeiten und sich bewusst sind, dass es sich um subjektive Zuschreibungen handelt – keine objektive Analyse.
Mario: Wie läuft die erste Phase der Anwendung ab? Was passiert beim ersten Schritt?
Dieter: Im ersten Schritt definieren wir gemeinsam mit den Teilnehmenden die Organisationseinheit und die relevanten Personen oder Gruppen. Dabei stellen wir Fragen wie: „Über welches Projekt sprechen wir?“ oder „Welche Personen sind in diesem Bereich relevant?“ Falls zu viele Personen involviert sind, fassen wir sie zusammen, zum Beispiel in Gruppen wie „Betriebsräte, die Co-Manager sind“. Wenn eine offene Atmosphäre herrscht, können auch Workshop-Teilnehmende selbst in das Organigramm eingebunden werden.
Mario: Und was passiert beim zweiten Schritt? Wie wird das offizielle Organigramm erstellt?
Dieter: Hier malen wir gemeinsam das offizielle Organigramm auf – entweder auf Papier oder digital. Wir lassen uns dieses vorher vom Coachee oder Verantwortlichen schicken. Falls kein offizielles Organigramm vorhanden ist, erarbeiten wir es gemeinsam anhand von Fragen wie: „Wer berichtet an wen?“ oder „Wer kann wem Anweisungen erteilen?“ Ziel ist es, die formale Rollenverteilung sichtbar zu machen und einen Vergleich zum späteren „verkehrten“ Organigramm zu ermöglichen.
Mario: Wie entsteht das „Organigramm verkehrt“ und was ist dabei zu beachten?
Dieter: Die Gruppe wird nun aktiv und visualisiert auf einer zweiten Pinnwand oder digitalem Board das „Organigramm verkehrt“. Dabei verschieben sie Karten, die einzelne Personen oder Gruppen repräsentieren. Diese Karten variieren in Größe je nach Einfluss – größere Karten bedeuten mehr Einfluss. Zudem vergeben sie Etiketten, die typische Rollen oder Verhaltensweisen beschreiben, etwa „Vermittler“, „Antreiber“ oder „Bürokrat“. Wichtig ist, dass alle Beteiligten ihre Anordnung selbst vornehmen und akzeptieren; es gibt kein Richtig oder Falsch.
Mario: Wie kann dieses Tool im Veränderungsprozess genutzt werden?
Dieter: Es dient als Ausgangspunkt für Diskussionen über Machtverhältnisse und Rollen innerhalb der Organisation. Mit den gewonnenen Erkenntnissen können Strategien entwickelt werden, um Einflussnehmer gezielt einzubinden oder Widerstände besser zu verstehen. Zudem fördert es ein gemeinsames Verständnis dafür, wie informelle Strukturen den Erfolg eines Veränderungsvorhabens beeinflussen.
Mario: Was ist Deiner Meinung nach der größte Vorteil dieses Ansatzes?
Dieter: Der größte Vorteil liegt darin, dass durch eine analoge und kreative Methode komplexe soziale Dynamiken sichtbar gemacht werden können. Es schafft ein gemeinsames Bild unter den Beteiligten und öffnet den Raum für Reflexion über Macht und Einfluss – Aspekte, die im klassischen Rationalen oft schwer greifbar sind. So wird Veränderung nicht nur auf der formalen Ebene geplant, sondern auch auf der informellen Ebene verstanden und gestaltet.
Mario: Dieter, nachdem das „Organigramm verkehrt“ erstellt und die Etiketten vergeben wurden, geht es um die sozialen Beziehungen zwischen den Personen. Wie gehst Du dabei vor?
Dieter: Wir ergänzen das Bild, indem wir Linien zwischen den Personen oder Gruppen ziehen, um positive oder negative Beziehungen sichtbar zu machen. Dabei verwenden wir unterschiedliche Farben und Strichstärken: beispielsweise eine dicke, grüne Linie für besonders positive Beziehungen und eine dünne, rote Linie für kritische oder negative Verbindungen. Das macht die sozialen Dynamiken auf anschauliche Weise sichtbar.
Mario: Warum ist es wichtig, diese sozialen Beziehungen zusätzlich zu visualisieren?
Dieter: Weil sie einen entscheidenden Einfluss auf die Organisation haben. Das formale Organigramm zeigt nur die offizielle Hierarchie, aber die informellen Beziehungen – wer sich gut versteht oder Konflikte hat – beeinflussen den Alltag und den Veränderungsprozess maßgeblich. Durch die Visualisierung wird deutlich, wo Potenziale für Kooperationen liegen oder wo Widerstände entstehen könnten.
Mario: Wie unterstützt Du die Gruppe oder den Coachee bei der Interpretation dieser beiden Organigramme?
Dieter: Ich leite sie an, die formale und die informale Struktur miteinander zu vergleichen. Wir schauen uns gemeinsam an, was spontan auffällt: Gibt es Abweichungen? Welche Bedeutung haben diese Unterschiede für das Veränderungsvorhaben? Wir diskutieren, welche Chancen sich aus der informellen Struktur ergeben und welche Hindernisse möglicherweise im Weg stehen. Ziel ist es, ein tieferes Verständnis für die tatsächlichen Einflussfaktoren zu entwickeln.
Mario: Und wie leitest Du daraus konkrete Maßnahmen für das Veränderungsprojekt ab?
Dieter: Wir stellen Fragen wie: „Was können Sie tun, um auf das Projekt noch besser Einfluss zu nehmen?“ oder „Wie können Sie die bestehende informelle Struktur nutzen?“ Dabei geht es auch darum, die eigene Rolle im Beziehungsgeflecht weiterzuentwickeln. Die Erkenntnisse aus der Analyse helfen dabei, gezielt Strategien zu entwickeln, um Einfluss zu gewinnen oder Widerstände abzubauen.
Mario: Abschließend – warum ist dieser iterative Ansatz so wertvoll im Veränderungsprozess?
Dieter: Weil er hinter die formalen Machtstrukturen blickt und zeigt, wie Akteure tatsächlich Einfluss nehmen. Das schafft Transparenz über Machtzusammenhänge und Interessen in der Organisation. Dadurch werden Unklarheiten abgebaut und der Spielraum der Beteiligten erweitert. Es ermöglicht eine bewusste Gestaltung des eigenen Einflusses und fördert eine nachhaltige Veränderung auf allen Ebenen.
Mario: Lieber Dieter, herzlichen Dank, dass ich bei Dir nachfragen durfte.
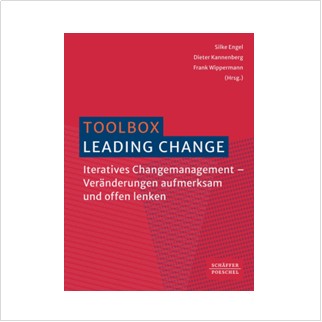
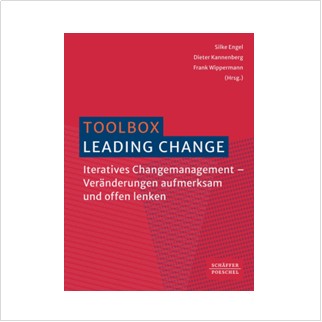
Toolbox Leading Change
Die Toolbox stellt eine Vielzahl von Change-Methoden vor, die speziell für Führungskräfte zu den Themen Prozessbegleitung, Methodenrepertoire und Analysetools entwickelt wurden. Es bietet digitale und analoge Verfahren, die sich besonders für das iterative Steuern von Change-Vorhaben eignen und somit auch für agiles Projektmanagement anschlussfähig sind. Anders als klassische Changemanagement-Toolsammlungen, die phasenorientiert vorgehen, liefert das Buch praxisnahe Anleitungen und Werkzeuge zum iterativen Vorgehen bei organisationalen Veränderungen. Die praxiserprobten Tools stammen aus der langjährigen Arbeit der flow consulting gmbh. Ein Roadmapping führt die Leser:innen in die verschiedenen Tools ein und gibt Orientierung, welches Tool sich für welchen Zweck und welches Format (Workshop, Coaching etc.) eignet.













