Den Gegenwind nutzen
Gerne frage ich Menschen nach ihren Ansichten, Strategien und Thesen, da mich ihre Arbeit und Standpunkte faszinieren. Für meine Kolumne NACHGEFRAGT habe ich mit dem geschäftsführenden Gesellschafter bei flow Consulting Frank Wippermann gesprochen. Er ist davon überzeugt, dass man in Veränderungen nicht immer einen geraden Kurs fährt, sondern – vergleichbar mit dem Segeln – einen Zick-Zack-Kurs. Ich habe ihn gefragt, wie man die Energie des Gegenwinds für den eigenen Kurs nutzen kann.
Mario: Frank, das Change-Tool „Gegenwind nutzen“ aus Deinem neuen Buch klingt nach einer sehr praxisnahen Herangehensweise. Kannst Du erklären, worum es bei diesem Tool genau geht?
Frank: Gerne. Bei Veränderungen gibt es immer Widerstand oder Gegenwind – die Gründe dafür sind vielfältig. Das Tool „Gegenwind nutzen“ konzentriert sich nicht auf die Ursachen, sondern auf die Maßnahmen, um mit diesem Gegenwind umzugehen. Es ist vergleichbar mit dem Segeln gegen den Wind: Man fährt keinen geraden Kurs, sondern einen Zick-Zack-Kurs, bei dem man ständig die Seite wechselt und Wenden macht. Ziel ist es, die Energie des Gegenwinds für den eigenen Kurs zu nutzen.
Mario: Das klingt nach einer sehr dynamischen Herangehensweise. Was ist der zentrale Nutzen dieses Tools für Veränderungsprozesse?
Frank: Es bietet kein starres Maßnahmenpaket, sondern ein Potpourri an Möglichkeiten, um den Veränderungskurs situativ anzupassen. Es hilft dabei, unterschiedliche Machtdimensionen sichtbar zu machen – also offene und verdeckte Formen von Gegenwind – und diese Energie gezielt für den Fortschritt zu nutzen. Es geht darum, flexibel zu bleiben und den Gegenwind als Ressource zu sehen.
Mario: Welche Voraussetzungen sollten denn erfüllt sein, damit dieses Tool effektiv eingesetzt werden kann?
Frank: Die Veränderung muss bereits in der Realität angekommen sein. Das bedeutet, dass die Beteiligten schon erste Erfahrungen mit neuen Routinen oder Abläufen gesammelt haben. Außerdem braucht es eine Haltung der Change-Agents: Neben Neugierde auf die Veränderung ist auch Unsicherheit normal – und diese Unsicherheit äußert sich oft in Widerstand. Wichtig ist, dass man Widerstand nicht nur als Störfaktor sieht, sondern als Energiequelle, die man für den eigenen Kurs nutzen kann.
Mario: Wie gehst Du mit Widerstand um? Sollten Change-Verantwortliche versuchen, ihn zu eliminieren?
Frank: Nein, das wäre der falsche Ansatz. Widerstand gehört zum Veränderungsprozess dazu und zeigt oft unterschiedliche Interessen oder Sichtweisen. Statt ihn zu bekämpfen, sollte man experimentieren: Verschiedene Maßnahmen ausprobieren, um die Gegenenergie kennenzulernen und für die Veränderung nutzbar zu machen. Das erfordert eine iterative Führungshaltung: Gerade weil nicht alles nach Plan läuft, bleibt man flexibel und passt den Kurs an – ähnlich wie beim Segeln gegen den Wind.
Mario: Und was rätst Du Change-Teams in komplexen Situationen? Wie können sie am besten vorgehen?
Frank: In komplexen Situationen ist Experimentieren entscheidend. Man sollte verschiedene Maßnahmen ausprobieren – symbolische ebenso wie inhaltliche –, um herauszufinden, was wirkt und was nicht. Dabei darf man auch mal vom ursprünglichen Ziel abweichen oder es anpassen. Das ist Teil eines iterativen Führungsverständnisses: Nicht stur am Plan festhalten, sondern kontinuierlich weitergestalten und auf neue Erkenntnisse reagieren.
Mario: Warum ist dieser Ansatz so wichtig in heutigen Veränderungsprozessen?
Frank: Weil er Flexibilität fördert und den Umgang mit Widerstand entmystifiziert. Veränderungen verlaufen selten linear; sie sind vielmehr ein ständiges Anpassen an neue Bedingungen und Energien im System. Mit diesem Ansatz lernen wir, Gegenwind nicht nur zu akzeptieren, sondern aktiv zu nutzen – das macht Veränderung nachhaltiger und weniger frustrierend für alle Beteiligten.


Frank Wippermann, geschäftsführender Gesellschafter der flow consulting gmbh, ist seit mehr als dreißig Jahren als Berater und Trainer international tätig. Seine Schwerpunkte: Komplexe Veränderungen durchführen, strategische Neuerungen umsetzen und Führungskräfte genau darauf vorbereiten. Er konzipierte den theoretischen Hintergrund der ‚Iterativen Beratung’ und entwickelt mit der flow-Forschungsgruppe neue praktische Beratungs- und Trainingswerkzeuge. Frank Wippermann studierte Elektrotechnik und Philosophie. Er ist EFQM-Assessor und Professional Scrum Master, Mitglied in der EGOS und Lehrbeauftragter zu Change Management und zu Leadership an verschiedenen Hochschulen.
Mario: Frank, Du sprichst von einem schrittweisen Ansatz bei der Nutzung von Gegenwind im Veränderungsprozess. Kannst Du zunächst erklären, warum die Klärung der Haltung und des Verhaltens der Change-Verantwortlichen so wichtig ist?
Frank: Die Haltung „Widerstand überwinden“ setzte ja voraus, dass die anderen vollkommen falsch liegen und ich die Wahrheit gepachtet habe. Bei der entgegengesetzten Haltung – „am Widerstand könnte was dran sein“ – geht es darum, Verständnis für die unterschiedlichen Wahrnehmungen der Beteiligten zu entwickeln – also zu akzeptieren, dass jeder seine eigene Sicht auf die Veränderung hat, basierend auf Interessen, Motiven und Bedürfnissen. Gleichzeitig ist es wichtig, eine Balance zwischen Routine und Innovation zu erkennen: Nicht alles wird verändert, aber auch nicht alles bleibt gleich. Diese Haltung bildet die Grundlage für eine offene Kommunikation und den Umgang mit Widerstand.
Mario: Welche konkreten Verhaltensweisen sind aus Deiner Sicht notwendig, um Gegenwind konstruktiv zu nutzen?
Frank: Es gibt sechs zentrale Punkte: Erstens wird Widerstand zugelassen und nicht sofort bekämpft. Zweitens werden aktiv Gespräche gesucht und angeboten. Drittens ist aktives Zuhören entscheidend, um Kritik – auch versteckte – zu verstehen und daraus Verbesserungen abzuleiten. Viertens werden kritische Perspektiven von Anfang an eingebunden. Fünftens sind Experimente und Tests keine Ausnahme, sondern werden aktiv gefördert. Und schließlich müssen klare Entscheidungen getroffen werden, bei denen die nächsten Schritte eindeutig kommuniziert werden.
Mario: Es geht also vor allem um Maßnahmenentwicklung. Was sind hier die wichtigsten Überlegungen?
Frank: Hier unterscheiden wir zwei Ebenen: Zum einen Maßnahmen, die den Rückenwind nutzen – etwa Meinungen einholen oder Pilotprojekte starten –, zum anderen die mikropolitische Ebene. Diese umfasst informelle Machtspiele und Einflussstrategien innerhalb der Organisation. Es ist wichtig, diese Einfluss-Taktiken gezielt anzuwenden und das Repertoire kontinuierlich zu erweitern. Dabei sollte man immer abwägen: Für wen sind welche Maßnahmen am erfolgversprechendsten? Und wie hoch ist der eigene Aufwand im Vergleich zur Wirkung?
Mario: Du sprichst von einer strategischen Ebene im Umgang mit Gegenwind. Wie kann man diese Einfluss-Taktiken konkret einsetzen?
Frank: Man analysiert zunächst die informellen Regeln und Machtspiele in der Organisation – also das sogenannte strategische Machtspiel. Dann wählt man gezielt Taktiken aus, um Einfluss zu nehmen: etwa durch gezielte Kommunikation, Allianzen oder das Schaffen von Mehrheiten. Wichtig ist dabei, nicht nur eine Maßnahme isoliert zu betrachten, sondern mehrere Taktiken im Blick zu haben – auch solche, die auf den ersten Blick vielleicht nicht direkt wirken –, um flexibel auf Reaktionen reagieren zu können.
Mario: Das klingt nach einer sehr strategischen Herangehensweise. Wie bereitet man sich auf mögliche Reaktionen vor?
Frank: Das ist der Kern des nächsten Schritts: Für jede Maßnahme schätzt man ab, wie Betroffene reagieren könnten. Dabei ist es hilfreich, bereits vor dem Start der Maßnahme mögliche Einwände oder Gegenargumente vorherzusehen – also eine Art Einwand-Vorwegnahme vorzubereiten. Außerdem sollten Vorabmaßnahmen geplant werden, um unerwünschte Reaktionen zu erschweren oder abzuschwächen. Erst wenn diese Vorbereitungen getroffen sind, kann man die eigentliche Gegenwind-Maßnahme starten.
Mario: Du betonst die Bedeutung eines iterativen Vorgehens beim Umgang mit Gegenwind. Warum ist das so wichtig?
Frank: Weil Veränderungen selten linear verlaufen. Es gibt immer unvorhergesehene Wendungen oder neue Widerstände. Ein iteratives Vorgehen bedeutet, dass man mehrere Maßnahmen vorbereitet hat – auch Maßnahmen zweiter Ordnung –, um flexibel reagieren zu können. So bleibt man handlungsfähig und kann sich besser auf Überraschungen einstellen. Das fördert nachhaltigen Erfolg und verhindert Frustration durch starr an einem Plan festzuhalten.
Mario: Abschließend gefragt: Was ist Deiner Meinung nach das wichtigste Prinzip beim Umgang mit Gegenwind in Veränderungsprozessen?
Frank: Das wichtigste Prinzip ist Flexibilität durch Planungsbreite: Nicht nur einzelne Maßnahmen planen und umsetzen, sondern ein ganzes Repertoire an Strategien entwickeln – inklusive Alternativen für unerwartete Wendungen. Damit schafft man eine robuste Basis für den Wandel und kann Gegenwind als Chance nutzen statt ihn nur als Hindernis zu sehen.
Mario: Lieber Frank, herzlichen Dank, dass ich bei Dir nachfragen durfte.
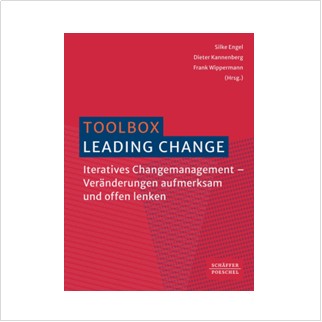
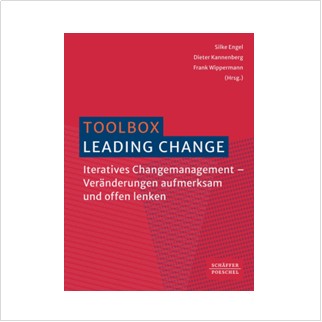
Toolbox Leading Change
Die Toolbox stellt eine Vielzahl von Change-Methoden vor, die speziell für Führungskräfte zu den Themen Prozessbegleitung, Methodenrepertoire und Analysetools entwickelt wurden. Es bietet digitale und analoge Verfahren, die sich besonders für das iterative Steuern von Change-Vorhaben eignen und somit auch für agiles Projektmanagement anschlussfähig sind. Anders als klassische Changemanagement-Toolsammlungen, die phasenorientiert vorgehen, liefert das Buch praxisnahe Anleitungen und Werkzeuge zum iterativen Vorgehen bei organisationalen Veränderungen. Die praxiserprobten Tools stammen aus der langjährigen Arbeit der flow consulting gmbh. Ein Roadmapping führt die Leser:innen in die verschiedenen Tools ein und gibt Orientierung, welches Tool sich für welchen Zweck und welches Format (Workshop, Coaching etc.) eignet.













